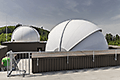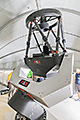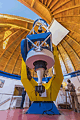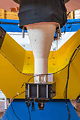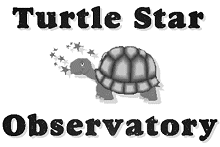
N 51° 25' 38.74" / E 6° 50' 37.16"
Höhe = 45 Meter / Obs.-Code = 628
©1998 TSO
Besucher seit dem 6.1.2021
|
2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar |
Am Morgen des 21. Januars beobachten wir die totale Mondfinsternis. In Ermangelung einer transportablen Montierung und weil dieses Himmelsereignis zudem relativ flach über dem Westhorizont stattfindet, kann dabei nur aus dem Fenster unserer Dachgeschosswohnung heraus mit einem normalen Fotostativ und stehender Kamera fotografiert werden. Die Bilder entstehen dabei eher "nebenbei", da wir uns zu dieser Uhrzeit bereits für den Weg zur Arbeit fertig machen müssen - daher auch die teilweise recht großen zeitlichen Lücken in der Aufnahmeserie.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| April |
Erste Tests des Programms "All Sky Plate Solver" verlaufen sehr vielversprechend: Das "stand-alone" laufende Programm analysiert dabei ein mit der CCD-Kamera aufgenommenes Foto und synchronisiert anschließend die Montierung mit den gefundenen Bild-Koordinaten. Voraussetzung hierfür ist nur, dass man zuvor die optischen Parameter der Aufnahme (Brennweite und Pixelgröße) eingegeben und einen zu diesen Werten passenden Referenzsternkatalog aus dem Internet herunter geladen hat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni |
Vom 14. bis 16. Juni nehmen wir an der 22. Kleinplanetentagung der VdS-Fachgruppe "Kleine Planeten" an der VEGA-Sternwarte in der Nähe von Salzburg in Österreich teil.
Anläßlich seines 75. Geburtstages wurden wir am 29. Juni von dem befreundeten Sternfreund Dieter Schwertfeger in die Räumlichkeiten der Astronomische Vereinigung Vulkaneifel am Hohen List e.V. eingeladen. Neben der eigentlichen Feier ergab sich hierbei auch die Gelegenheit das gesamte Sternwartengelände von außen, sowie die Kuppel des 1m Nasmyth-Cassegrain-Telekops von innen zu besichtigen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli |
In einer Wolkenlücke können wir trotz stark dunstigem Himmel für kurze Zeit einen Blick auf die partielle Mondfinsternis vom 16. Juli erhaschen. Hierbei gelingen sogar noch einige Aufnahmen mit 600mm Brennweite "aus freier Hand" aus dem Dachfenster heraus.
Angeregt durch die diesjährige Kleinplanetentagung im Juni, beginnen wir nach achtjähriger Pause wieder mit der Photometrie von Kleinplaneten. Weil die bisher von uns hierfür verwendete Software "AIP4Win" jedoch nicht mehr unter Windows 10 lauffähig ist, benutzen wir zunächst die aktuelle Version der Astrometrie-Software "Astrometrica" zur Auswertung unserer Bilderserien. Erste Messungen an zwei 13 bzw. 14mag hellen Objekten in den folgenen Wochen sehen dabei recht vielversprechend aus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| August |
Der mit uns befreundete Amateurastronom André van Staden aus Bredasdorp in Südafrika veröffentlicht den inzwischen vierten Artikel zu den von ihm beobachteten Lichtkurven-Unregelmäßigkeiten des Begleiters des Millisekunden-Pulsars PSR J1723-2837 im Sternbild "Schlangenträger". Er erscheint in der August-Ausgabe des vierteljährlich erscheinenden Mitteilungsblattes der Astronomical Society of Southern Africa (ASSA). Klicken Sie zum Lesen auf das unten stehende PDF-Icon.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| September |
Nachdem wir bereits im August mit der Beobachtung des ca. 12mag hellen Kleinplaneten (702) Alauda begonnen hatten, zeigten sich schnell die Schwächen von "Astrometrica" bei der Photometrie:
Noch komfortabler gestaltet sich die Messung mit Hilfe der direkt unter Windows 10 lauffähigen Software "MuniWin". Auch dieses Programm kann in seiner aktuellen Version inzwischen auch bewegte Objekte für die Photometrie verfolgen. Anders als "AIP4Win" photometriert es aber nicht nur die zwei vom Benutzer festgelegten Vergleichssterne, sondern direkt alle punktförmigen Objekte in allen Bildern der Serie. Hierdurch kann man sehr komfortabel zwischen verschiedensten Vergleichssternen hin und her schalten. Nicht selten stößt man dabei auf einer, eigentlich nur für die Photometrie eines Kleinplaneten vorgesehenen Bilderserie auch auf andere veränderliche Objekte... Auch hier liegt die Auswertedauer einer Aufnahmeserie mit mehr als 800 Bildern bei weniger als 15 Minuten. Aus unseren Beobachtungen des bereits weiter oben erwähnten Kleinplaneten (702) Alauda ergibt sich, dass es während der diesjährigen Opposition anscheinend zu gegenseitigen Verfinsterungen zwischen dem Kleinplaneten und einem ihn umkreisenden Mond kommt. Ein solcher Mond war zwar bereits 2011 bei Beobachtungen mit dem Very Large Telescope in Chile entdeckt worden, die jetzigen Beobachtungen lassen sich aber nicht mit der damals berechneten Größe dieses Mondes erklären. Entweder ist der Mond von (702) Alauda deutlich größer als bisher angenommen, oder es existiert eventuell noch ein zweiter Mond? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober |
Auf Wunsch von Dr. Raoul Behrend, mit dem wir auf dem Gebiet der Photometrie zusammen arbeiten, stellen wir unsere Bildaufnahmepraxis von 2x2-Binning auf 1x1-Binning um. Die hierdurch entstehenden Nachteile, wie die geringere erreichbare Grenzhelligkeit bei einer vorgegebenen Belichtungszeit oder die größere Anfälligkeit gegenüber Nachführfehleren, wird durch eine verbesserte Dynamik der Bilder und den statistisch bedingt kleineren Messfehler wieder gut gemacht. Letzterer liegt bei einem ca. 13mag hellen Objekt nun meist um 0,004mag!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| November |
Am 9. November besuchen die Mitglieder des TSO die 38. Bochumer Herbsttagung (BoHeTa) an der Ruhr-Universität. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiter zum Jahr 2020
Zurück zum Jahr 2018
Zurück zur TSO-Startseite